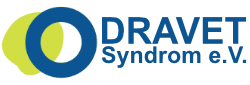Ursächlich spielen vor allem neurologische und genetische Aspekte eine Rolle. Die genetische Veränderung im SCN1A-Gen beeinträchtigt die normale Entwicklung neuronaler Netzwerke – und damit auch jene Fähigkeiten, die für Sprache und Kommunikation wichtig sind.
Hinzu kommt, dass die teils sehr häufigen und schweren epileptischen Anfälle, besonders im frühen Kindesalter, die Sprachentwicklung zusätzlich verzögern oder behindern können.
Auch eine begleitende kognitive Beeinträchtigung oder ein autistisches Verhalten wirken sich oft negativ auf die sprachliche Ausdrucks- und Verstehensfähigkeit aus.
Dravet-Betroffene können in allen oder nur einigen Bereichen der Sprachentwicklung Schwierigkeiten haben. Die Symptome reichen dabei von leichten sprachlichen Verzögerungen bis hin zu völliger Nonverbalität.
Einige Dravet-Betroffene sprechen in Ein-Wort-Sätze oder verfügen über einen stark eingeschränkten Wortschatz. Andere können sich zwar sprachlich ausdrücken, haben aber Schwierigkeiten mit der sozialen Kommunikation, zum Beispiel beim Wechsel von Gesprächsthemen, beim Erfassen nonverbaler Signale oder beim Verständnis von Metaphern und Ironie.
In manchen Fällen wird auch ein Rückschritt in der Sprachentwicklung beobachtet, etwa nach einem Status epilepticus oder einer Phase mit häufigen Anfällen.
Eine frühzeitige sprachtherapeutische Unterstützung kann helfen, die individuellen kommunikativen Fähigkeiten bestmöglich zu fördern. Logopäden beurteilen alle Bereiche der Sprachentwicklung, vom Sprachverständnis über den Wortschatz bis hin zur sozialen Interaktion und entwickeln passgenaue Förderansätze. Dabei arbeiten sie eng mit den Eltern und Betreuungspersonen zusammen. Ein besonderer Fokus liegt auch auf der Gestaltung einer förderlichen Kommunikationsumgebung, zum Beispiel durch den Einsatz vereinfachter Sprache oder visueller Hilfsmittel.
Wenn die verbale Sprache stark eingeschränkt ist oder gar nicht möglich, bieten sich alternative Kommunikationsformen an. Dazu zählt etwa das Picture Exchange Communication System® (PECS®), bei dem Kinder mithilfe von Bildern ausdrücken können, was sie möchten oder brauchen. Auch Makaton, ein System aus Schlüsselwortzeichen und Symbolen, das Sprache mit Gebärden kombiniert, wird häufig erfolgreich eingesetzt. Für manche Kinder kann zudem ein sogenanntes AAC-Gerät, ein Tablet oder Computer mit spezieller Kommunikationssoftware, eine wichtige Unterstützung im Alltag sein.
Wichtiger Hinweis für Eltern
Unabhängig vom Alter gilt: Es ist nie zu spät, mit einer logopädischen Förderung zu beginnen. Studien und Erfahrungen zeigen jedoch, dass ein früher Start – idealerweise schon mit zwei bis drei Jahren – besonders wirksam ist. Wenn dein Kind Ess- oder Trinkschwierigkeiten hat, werden diese in die Therapie mit einbezogen. Auch in Schulen für Kinder mit Förderbedarf sind Sprache und Kommunikation feste Bestandteile des Lehrplans, sodass dein Kind gezielt nach seinen Bedürfnissen unterstützt werden kann.
Für dich kann es hilfreich sein, dich über verschiedene Angebote zu informieren und gemeinsam mit Ärztinnen, Therapeutinnen und Pädagog*innen einen individuellen Förderweg für dein Kind zu entwickeln. Sprach- und Kommunikationsprobleme sind zwar eine Herausforderung, aber mit gezielter Unterstützung kann dein Kind viele Fortschritte machen.