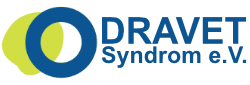Die Ursachen für diese Probleme sind vielschichtig. Im Zentrum steht die SCN1A-Mutation, die beim Dravet-Syndrom nicht nur die Erregbarkeit der Nervenzellen beeinflusst, sondern auch das neuroendokrine System, das wichtige Wachstums- und Stoffwechselprozesse steuert.
Aktuelle Studien zeigen, dass Kinder mit Dravet-Syndrom im Vergleich zu gesunden Kindern signifikant niedrigere Spiegel des Wachstumshormons IGF‑1 und des männlichen Geschlechtshormons Testosteron aufwiesen, beides Hormone, die für das normale Körperwachstum und die Entwicklung wichtig sind. Auffällig war, dass viele der betroffenen Kinder kleiner und leichter als ihre Altersgenossen waren, ein klarer Hinweis auf eine Gedeihstörung, die über bloße Essprobleme hinausgeht.
Ein weiterer zentraler Faktor ist die Medikation: Einige Antiepileptika, beispielsweise Fenfluramin, Valproinsäure und Stiripentol, sind dafür bekannt, den Appetit zu hemmen, den Stoffwechsel zu verändern oder die Knochendichte zu beeinflussen. Auch chronische Anfälle können dazu führen, dass der Körper weniger effektiv Nährstoffe verwertet. Hinzu kommt bei vielen Dravet-Betroffenen ein niedriger Muskeltonus, der das Kauen und Schlucken erschwert, ebenso wie Verhaltensmerkmale bei gleichzeitiger Autismus-Diagnose, z. B. sensorische Aversionen gegenüber bestimmten Lebensmitteln oder Essenssituationen.
Familien berichten häufig, dass ihre Kinder mit Dravet-Syndrom appetitlos, sehr wählerisch beim Essen oder leicht reizbar beim Füttern sind. Viele Dravet-Betroffene essen extrem langsam, trinken wenig oder haben Schwierigkeiten, Gewicht zuzulegen. In der Literatur werden besonders folgende Probleme beschrieben:
- Gedeihstörung: Wachstumsverzögerung, Untergewicht, geringer Muskelaufbau
- Osteopenie: Verminderte Knochendichte, teilweise durch Medikamente bedingt
- Schluckstörungen: Koordinationsprobleme beim Kauen, Verschlucken, teils mit Aspirationsgefahr
- Mangelernährung: Kalorien- und Nährstoffaufnahme reichen nicht aus – trotz regelmäßiger Mahlzeiten
- Verdauungsprobleme: Besonders Verstopfung ist sehr häufig, ebenso wie Inkontinenz
- Skoliose: Eine häufige Begleiterkrankung, teils im Zusammenhang mit Muskelhypotonie und Unterernährung
Besonders kritisch wird es, wenn durch wiederholte Essverweigerung oder ineffektive Nahrungsaufnahme das Wachstum deutlich stagniert oder das Gewicht auf die untere Perzentile fällt. In einer aktuellen Studie zeigten über 17 Prozent der Kinder mit SCN1A-bedingten Epilepsien eine so schwere Essstörung, dass eine Ernährungssonde notwendig wurde.
Viele dieser Probleme lassen sich mit einem individuellen und interdisziplinären Therapieansatz deutlich verbessern. Wichtig ist, dass Wachstumsverlauf und Essverhalten regelmäßig dokumentiert und frühzeitig Veränderungen besprochen werden. Wenn Eltern Auffälligkeiten wie starkes Untergewicht, Müdigkeit nach dem Essen oder Schluckbeschwerden beobachten, sollten sie das medizinische Team aktiv einbeziehen.
Empfohlene Maßnahmen sind:
- Ernährungsmedizinische Beratung: Fachkräfte für Pädiatrische Ernährung oder Gastroenterologie helfen dabei, die Ursachen der Essprobleme zu klären, Essenssituationen zu gestalten und gegebenenfalls Nahrungsergänzungen einzusetzen.
- Logopädie und Schlucktherapie: Besonders bei Kindern mit auffälliger Schluckkoordination, häufigem Verschlucken oder Angst vor bestimmten Konsistenzen ist die Zusammenarbeit mit einem auf Dysphagie spezialisierten Logopäden hilfreich.
- Anpassung der Medikation: Wenn Medikamente den Appetit stark beeinträchtigen, kann in Absprache mit dem Arzt eine Umstellung helfen.
- PEG- oder Button-Sonde (Gastrostomie): Wenn die orale Nahrungsaufnahme nicht mehr ausreicht, ist eine Sondenernährung oft der einzige Weg, um Mangelernährung und chronische Erschöpfung zu verhindern. Aktuelle Studien zeigen, dass eine PEG-Sonde nicht bedeutet, dass Kinder nie wieder essen, sondern ihnen schlicht den Druck nimmt und eine ergänzende Nahrungsaufnahme ermöglicht, auch für Medikamente oder Flüssigkeit. Viele Eltern berichten, dass dieser Schritt rückblickend eine große Entlastung war. Erfahre hier mehr dazu.