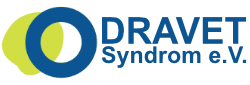Das Dravet-Syndrom wird meist durch eine Veränderung im sogenannten SCN1A-Gen verursacht. Dieses Gen enthält die Bauanleitung für einen bestimmten Natriumkanal, der wichtig ist für die Weiterleitung elektrischer Signale im Körper. Solche Signale sind entscheidend – nicht nur im Gehirn, sondern auch im Herzmuskel. Deshalb kann eine Veränderung in diesem Gen auch das Herz beeinflussen.
In Tierversuchen mit Mäusen, die eine solche SCN1A-Mutation hatten, wurde festgestellt, dass die elektrische Steuerung des Herzens gestört war. Die Mäuse hatten zum Beispiel verlängerte QT-Intervalle (eine bestimmte Phase im Herzschlag war zu lang) und Extraschläge, also zusätzliche Herzschläge, die den Rhythmus durcheinanderbringen können. Solche Störungen gelten als Risikofaktor für den plötzlichen unerwarteten Tod bei Epilepsie (SUDEP).
Auch Fachleute wie die US-amerikanische Kardiologin und Epileptologin Alicia M. Goldman weisen darauf hin, dass es beim Dravet-Syndrom oft sehr feine Störungen im Herzrhythmus gibt, die schwer zu messen sind. Besonders nach einem epileptischen Anfall – wenn die Atmung flach ist und das Herz unregelmäßig schlägt – steigt das Risiko für SUDEP.
Nicht alle Dravet-Betroffenen zeigen offensichtliche Herzsymptome. Wenn sie auftreten, können sie schwer erkennbar sein oder mit anderen Symptomen verwechselt werden. Zu den möglichen Anzeichen zählen:
- Unregelmäßiger Herzschlag (Arrhythmien), insbesondere vor, während oder nach einem Anfall
- Verlangsamter Hertschlag (Bradykardie), vor allem in der Ruhe oder in der postiktalen Phase
- QT-Zeit-Verlängerung – das bedeutet, dass das Herz länger braucht, um sich elektrisch zu erholen – ein Hinweis auf eine gestörte Herzrhythmussteuerung
- Müdigkeit, Blässe, Schwindel oder kurze Bewusstlosigkeit (in seltenen Fällen)
In einer Untersuchung mit Langzeit-EKGs wurden bei Dravet-Betroffenen rund um Anfälle (periiktal) häufiger Herzrhythmusstörungen festgestellt als bei Patienten mit anderen Epilepsieformen.
Auch wenn solche Arrhythmien (also unregelmäßige Herzschläge) nicht immer gefährlich sind, sollten sie bei Dravet-Betroffenen ernst genommen und ärztlich überwacht werden – vor allem wegen des erhöhten Risikos für Komplikationen wie SUDEP.
Eine regelmäßige Überwachung der Herzfunktion ist besonders dann sinnvoll, wenn
- die betroffene Person plötzliche Ohnmachtsanfälle ohne erkennbare Ursache hat,
- auffällige Veränderungen im EKG festgestellt wurden,
- oder das Medikament Fenfluramin (Handelsname: Fintepla) zur Anfallsbehandlung eingesetzt wird.
Fenfluramin hat sich in mehreren Studien als sehr wirksam gegen Anfälle beim Dravet-Syndrom erwiesen. Es steht allerdings im Verdacht, bei langfristiger Einnahme Herzklappenveränderungen oder pulmonale Hypertonie (hohem Blutdruck in der Lunge) auszulösen, ein Risiko, das man aus seiner früheren Verwendung als Appetitzügler kennt.
In der Zulassungsstudie und auch in der Langzeitstudie zeigten sich zwar keine klinisch relevante Herzschädigung über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren. Trotzdem wird empfohlen, alle sechs Monate eine Ultraschalluntersuchung des Herzens (Echokardiographie) zu machen, um mögliche Probleme früh zu erkennen.