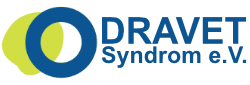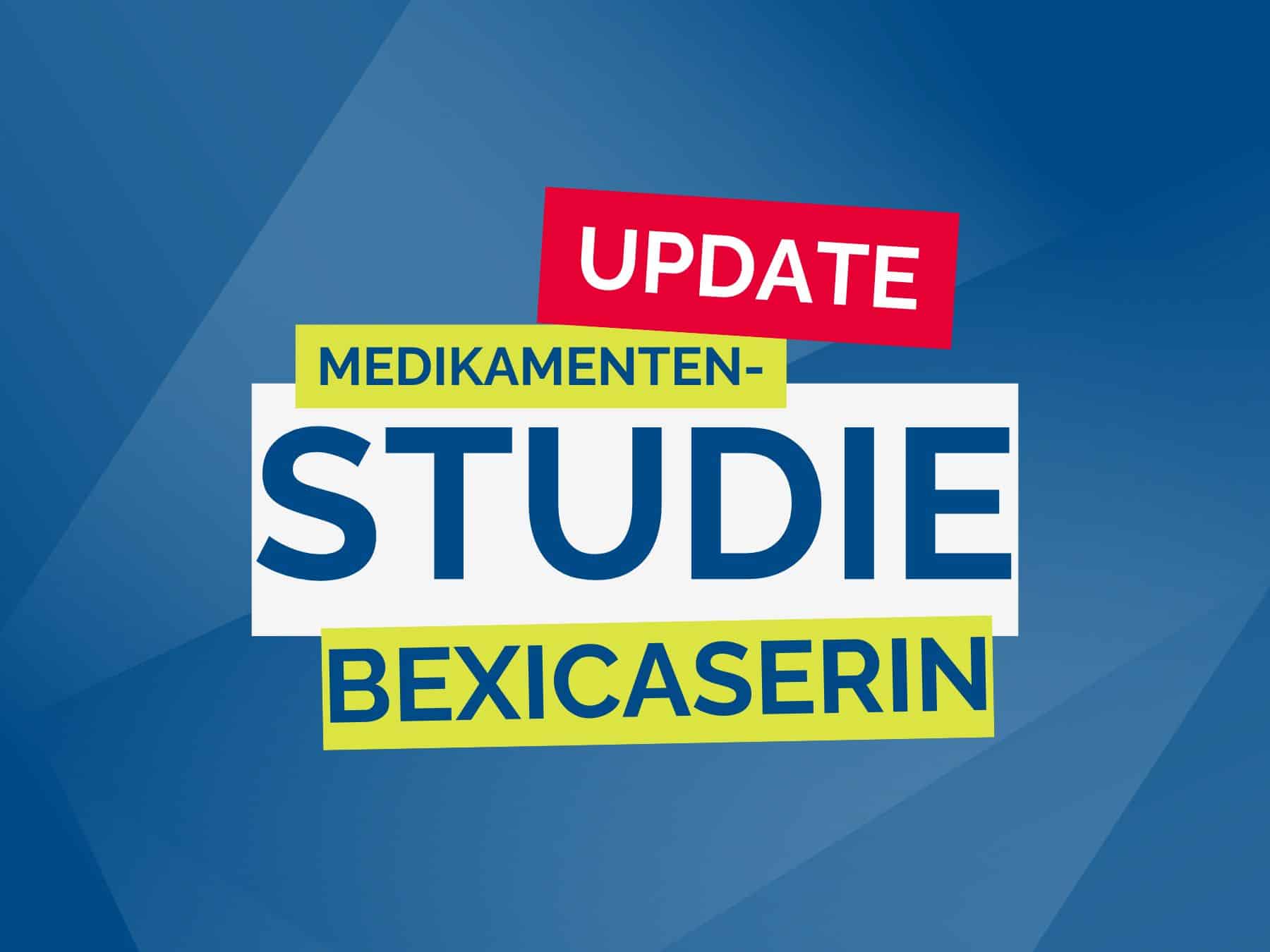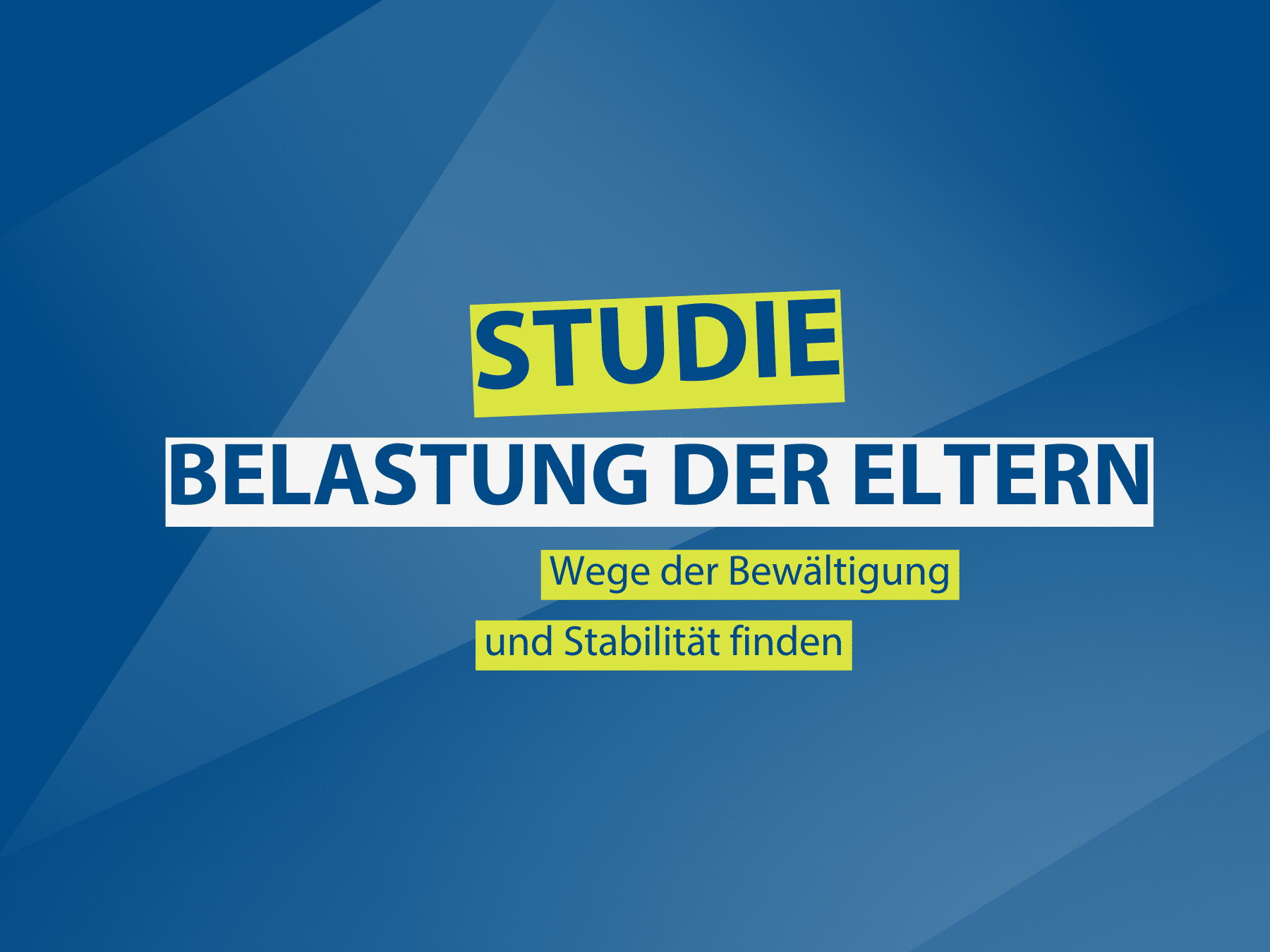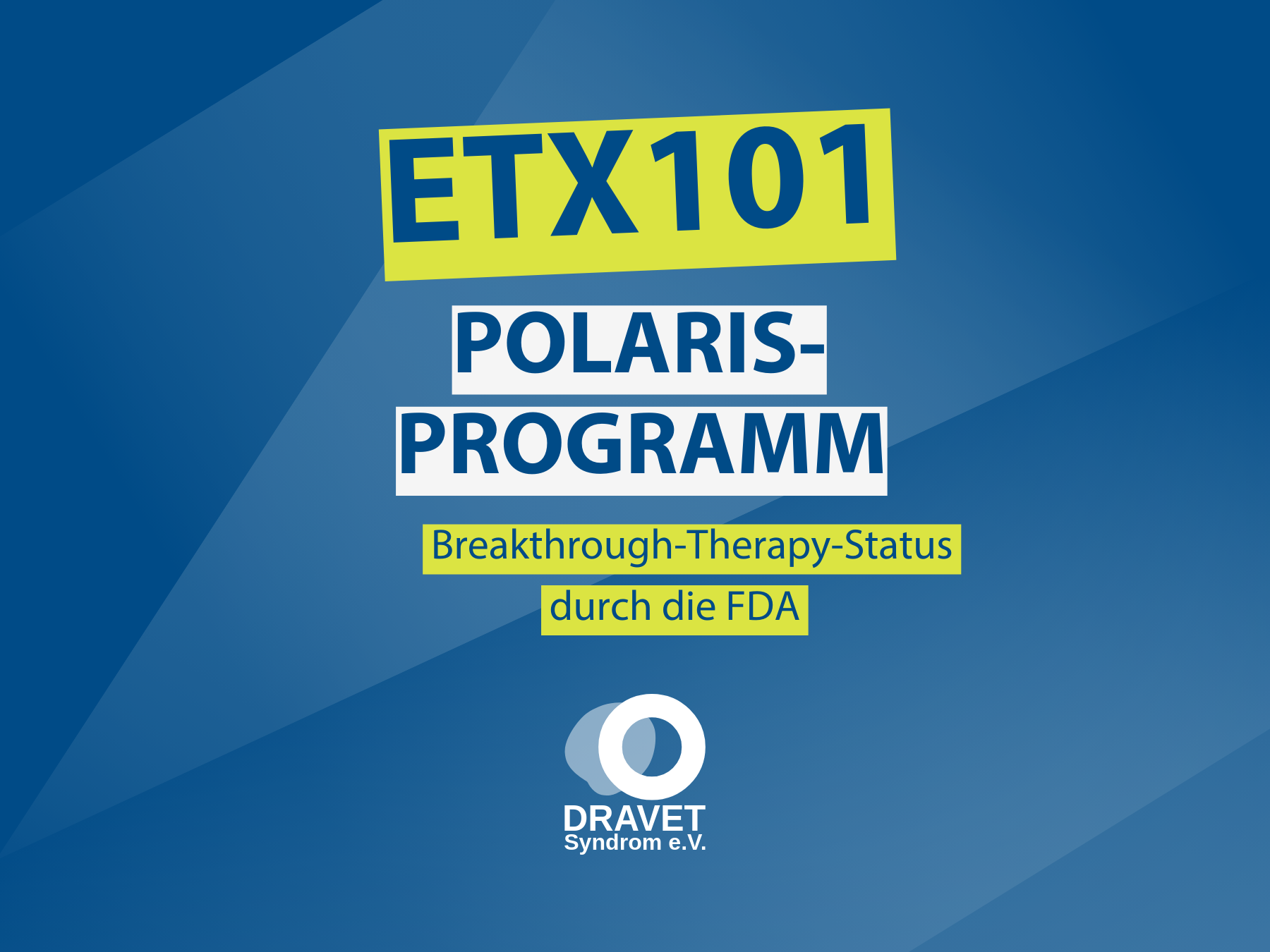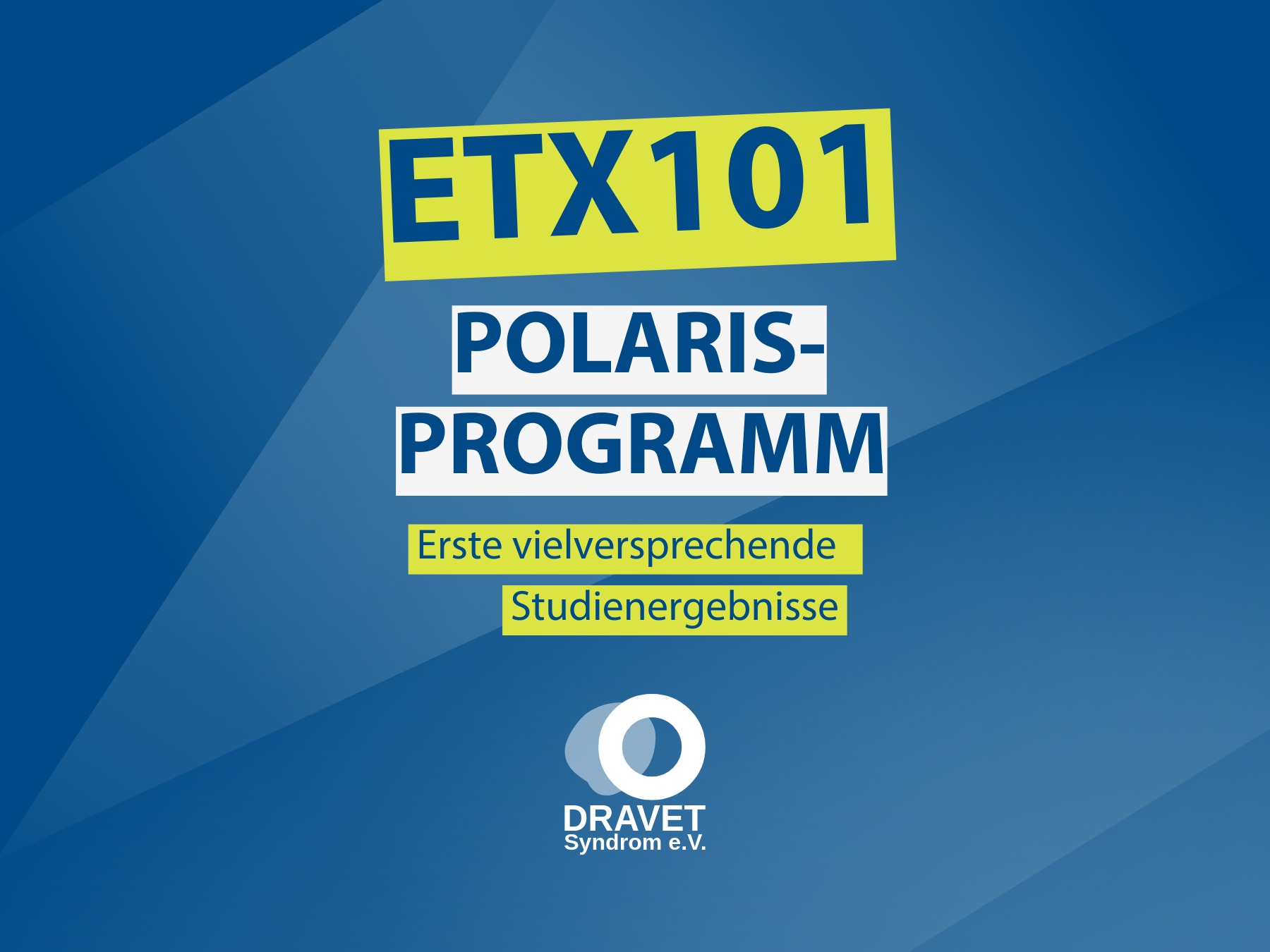Die Firma Lundbeck hat positive Ergebnisse der 12-monatigen Open-Label-Extension (OLE) der PACIFIC-Studie zu Bexicaserin veröffentlicht. Die Studie untersucht das Potenzial des Wirkstoffs zur Behandlung von Entwicklungs- und Epileptischen Enzephalopathien (DEEs).
DEE umfasst eine Gruppe seltener, schwerer neurologischer Störungen, die sich durch früh einsetzende, therapieresistente Epilepsien und eine gestörte Gehirnentwicklung mit kognitiven und motorischen Beeinträchtigungen auszeichnen. Darunter fällt auch das Dravet-Syndrom.
Die Open-Label-Extension ist eine Phase-2-Langzeitstudie, die sich an Teilnehmende richtet, die die vorherige PACIFIC-Studie abgeschlossen haben. Ihr Hauptziel besteht darin, die langfristige Sicherheit und Verträglichkeit von Bexicaserin zu untersuchen.
Ergebnisse der Studie
Die neuesten Daten zeigen, dass die Behandlung mit Bexicaserin über einen Zeitraum von zwölf Monaten zu einer signifikanten Reduktion der Anfallshäufigkeit führte. Die Zahl der motorischen Anfälle verringerte sich im Median um 59,3 Prozent.
Patienten, die bereits in der ursprünglichen PACIFIC-Studie mit Bexicaserin behandelt wurden, erzielten sogar eine Reduktion der Anfallshäufigkeit um 60,4 Prozent.
Auch Patienten, die in der ersten Studienphase zunächst ein Placebo erhalten hatten und anschließend in der OLE-Phase auf Bexicaserin umgestellt wurden, zeigten eine Reduktion der Anfälle um 58,2 Prozent.
Sicherheit und Verträglichkeit
Neben der positiven Wirkung auf die Anfallshäufigkeit erwies sich Bexicaserin auch als gut verträglich. Von den 41 Patienten, die an der Langzeitstudie teilnahmen, blieben 92,7 Prozent während der gesamten zwölf Monate in der Studie. Die häufigsten Nebenwirkungen waren leichte bis mittelschwere Infektionen der oberen Atemwege, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, gelegentlich auftretende Müdigkeit, Gangstörungen, Erbrechen und Hautausschläge. Lediglich ein Patient brach die Studie aufgrund von Nebenwirkungen ab.
Bexicaserin gilt als vielversprechender Wirkstoff für die Behandlung von DEEs. Es handelt sich um einen selektiven 5‑HT2C-Rezeptor-Superagonisten, der gezielt die Signalübertragung im Gehirn beeinflusst. Aufgrund der positiven Ergebnisse der Phase I- und II-Studien geht es jetzt in die Phase III (Zulassungsstudie). Diese wird global zur Verfügung stehen. Welche Länder wann an den Start gehen, ist noch nicht endgültig geklärt. Es werden aber strenge Ein- und Ausschlusskriterien gefordert.
Wirkt Bexicaserin wie Fenfluramin?
Die Ähnlichkeit zum Wirkmechanismus von Fenfluramin wird einigen aufgefallen sein. Fenfluramin ist kein selektiver 5‑HT2C-Rezeptor-Agonist, sondern wirkt auch auf die Rezeptoren 5‑HT1D und 5‑HT2C sowie dem Sigma-1-Rezeptor.
Die vollständigen Ergebnisse der OLE-Studie werden voraussichtlich 2025 auf einer medizinischen Konferenz vorgestellt. Wir halten Euch über alle Neuigkeiten rund um Bexicaserin auf dem Laufenden.
Hier gelangt Ihr zur Pressemitteilung von Lundbeck.