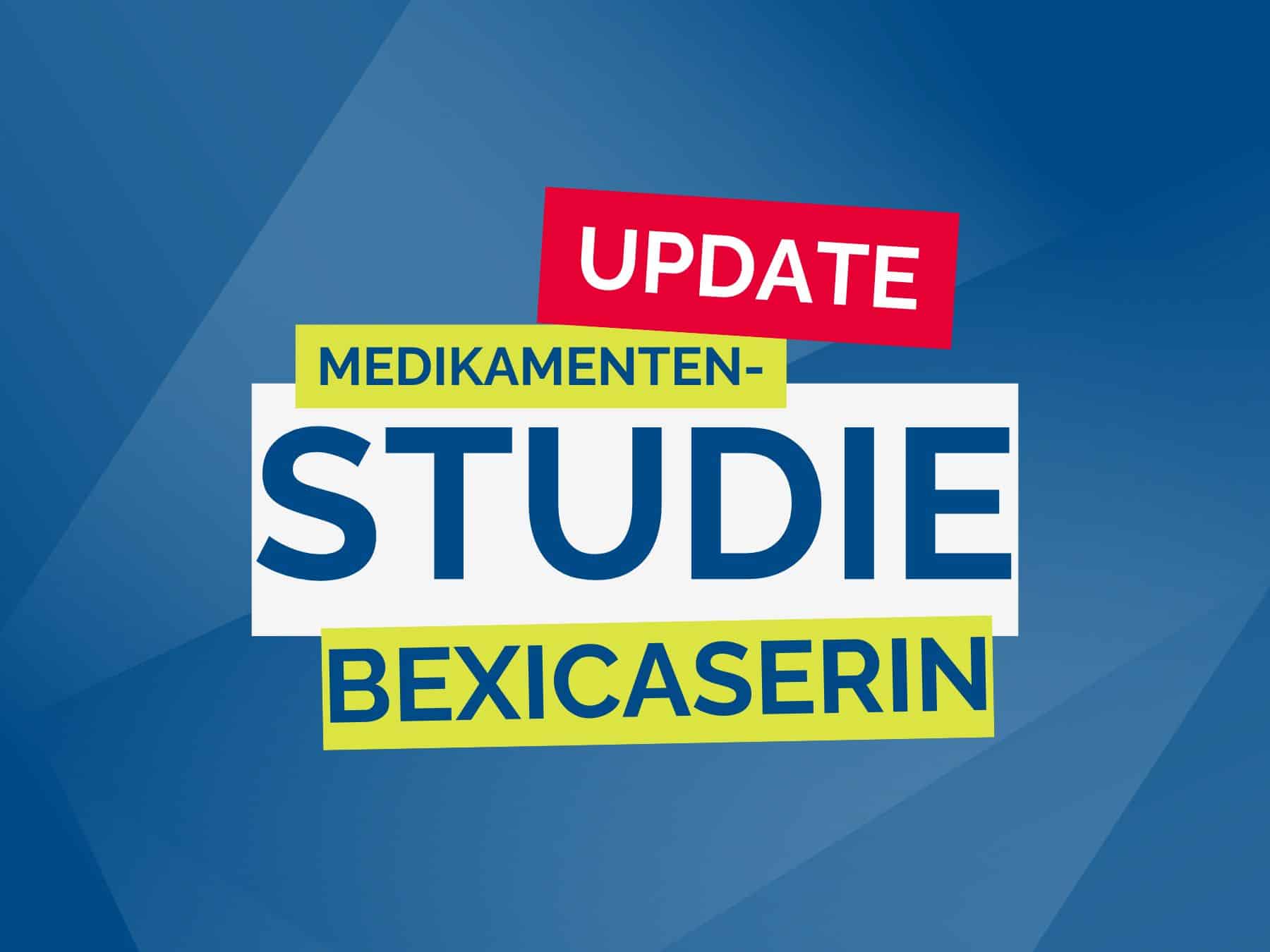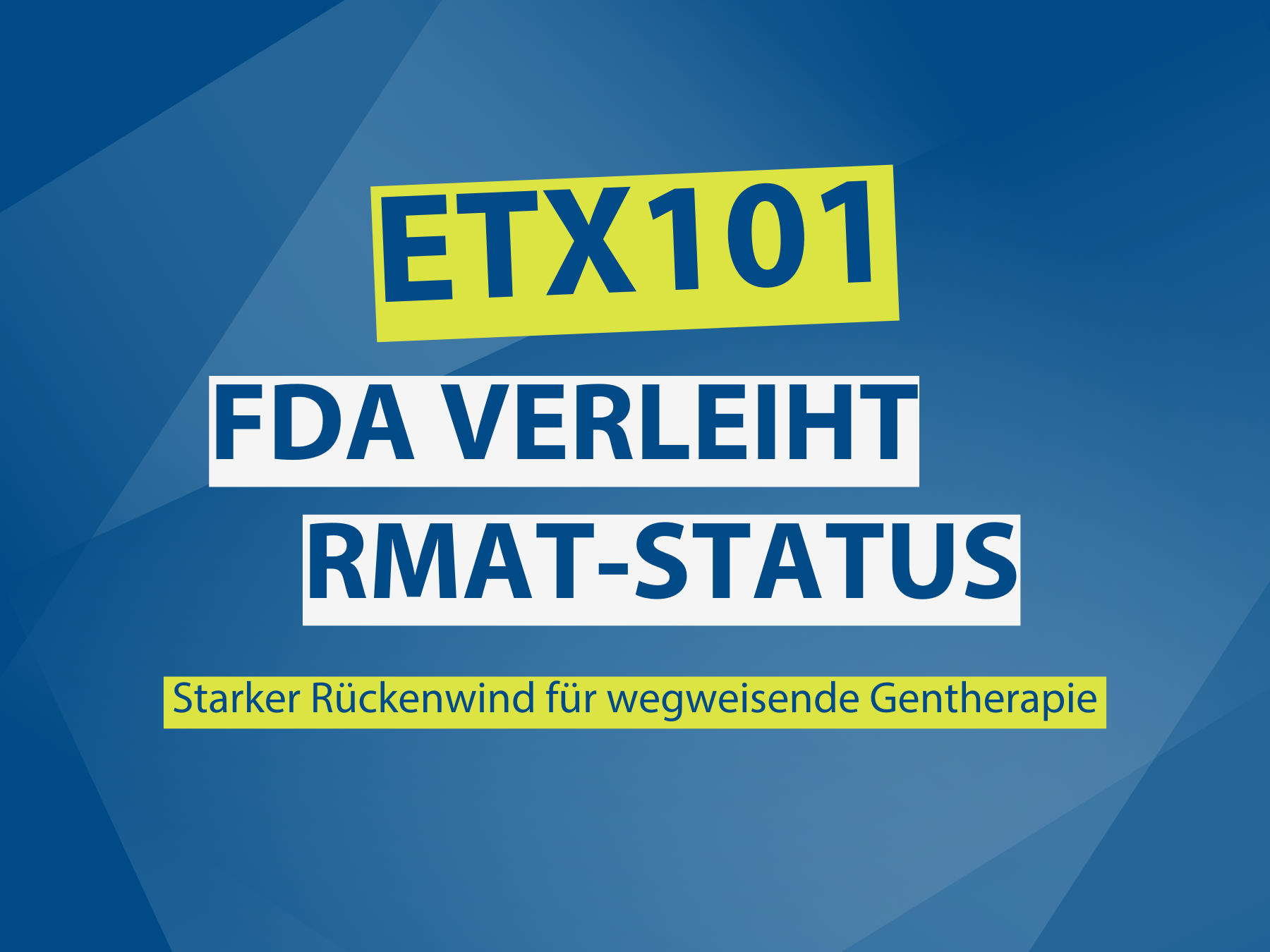Stoke Therapeutics und Biogen haben auf der 54. Jahrestagung der Child Neurology Society (CNS) neue Daten zur laufenden Behandlung mit Zorevunersen (STK-001) vorgestellt. Die Ergebnisse stammen aus den offenen Langzeitverlängerungen der Studien MONARCH und ADMIRAL und zeigen über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren anhaltende Verbesserungen in mehreren klinisch relevanten Bereichen.
Die Daten stützen die Annahme, dass Zorevunersen über die Anfallskontrolle hinaus auch positive Effekte auf Verhalten, Kognition und Alltagsfähigkeiten haben könnte und somit das Potenzial einer krankheitsmodifizierenden Therapie weiter bekräftigt.
Anhaltende Wirksamkeit über drei Jahre
Die nun präsentierten Ergebnisse umfassen Beobachtungen von 19 Kindern und Jugendlichen mit Dravet-Syndrom, die über längere Zeiträume regelmäßig mit Zorevunersen behandelt wurden.
Nach zwei Jahren zeigten die Teilnehmenden im Durchschnitt deutliche Verbesserungen in Verhalten und Kognition, während in einer unbehandelten Vergleichsgruppe kaum Veränderungen beobachtet wurden. Diese Fortschritte spiegeln sich in der Vineland-3-Skala wider, die unter anderem Kommunikation, soziale Fähigkeiten und Alltagskompetenzen erfasst.
Nach drei Jahren berichteten Ärzt*innen und Betreuungspersonen, dass 95 % der Kinder (18 von 19) eine klinische Gesamtverbesserung zeigten. Außerdem blieb die Häufigkeit schwerer motorischer Anfälle bei den meisten Teilnehmenden um mehr als 80 % reduziert – eine Wirkung, die über die gesamte Beobachtungszeit hinweg stabil blieb.
Diese Ergebnisse bestätigen die positiven Trends aus den früheren Studienphasen und untermauern den möglichen langfristigen Nutzen von Zorevunersen.
Verträglichkeit und Sicherheit
Zorevunersen wurde über den gesamten Zeitraum weiterhin gut vertragen. In der ursprünglichen Phase‑1/2a-Studie traten bei rund 30 % der Teilnehmenden behandlungsbedingte Nebenwirkungen auf, in der offenen Verlängerungsphase lag dieser Anteil bei 53 %.
Am häufigsten zeigte sich ein erhöhter Eiweißgehalt im Nervenwasser (Liquor), definiert als Anstieg um ≥ 50 mg/dL. Dieser Befund blieb in den meisten Fällen ohne klinische Symptome, führte aber in einem Fall zum Studienabbruch.
Die Forschenden bewerten das Sicherheitsprofil weiterhin als stabil und beherrschbar, weisen jedoch auf die Notwendigkeit einer fortlaufenden Beobachtung hin, insbesondere bei längerer Anwendungsdauer.
Bedeutung der Ergebnisse
Die neuen Daten sind ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer Therapie, die direkt an der Ursache des Dravet-Syndroms ansetzt. Die über Jahre anhaltenden Verbesserungen in Verhalten, Kognition und Anfallskontrolle geben Anlass zu vorsichtiger Zuversicht, dass Zorevunersen tatsächlich mehr bewirken könnte als eine reine Symptombehandlung.
Zugleich bleibt zu beachten, dass die Teilnehmerzahl der bisherigen offenen Studien klein ist und die endgültige Bewertung erst mit den Ergebnissen der laufenden Phase-III-Studie EMPEROR möglich sein wird.
Ausblick
Die Phase-III-Studie EMPEROR läuft derzeit in den USA, im Vereinigten Königreich und in Japan. Stoke plant den europäischen Studienstart für Anfang 2026. Ziel ist es, die bisherigen Ergebnisse in einer größeren, kontrollierten Patientengruppe zu bestätigen.
Bestätigen sich die bisherigen Verbesserungen, verändert Zorevunersen den Krankheitsverlauf beim Dravet-Syndrom möglicherweise erstmals ursächlich. Mit Ergebnissen der Phase-III-Studie ist laut Stoke frühestens im zweiten Halbjahr 2027 zu rechnen.
Hier geht es zur Pressemitteilung von Stoke.