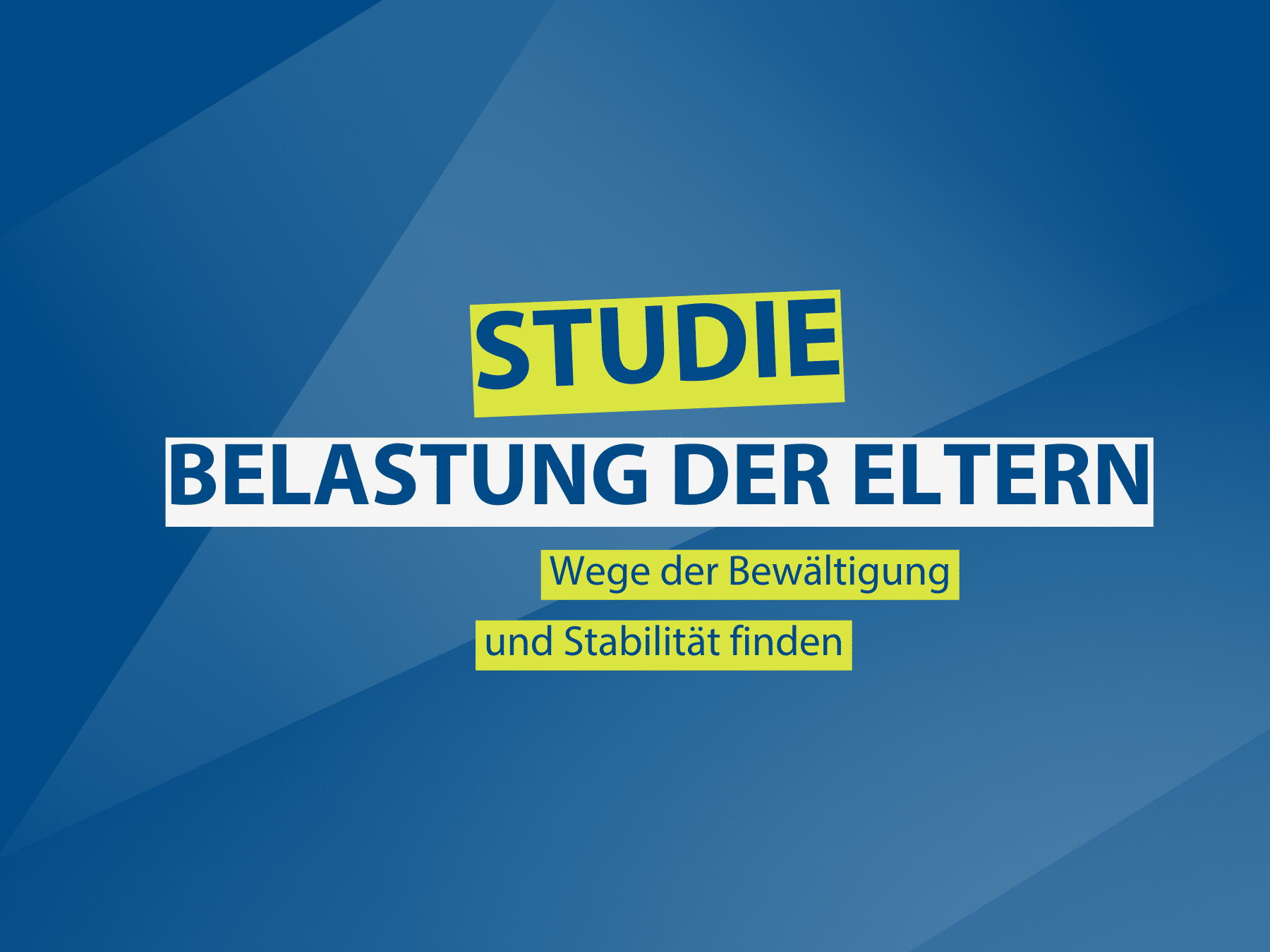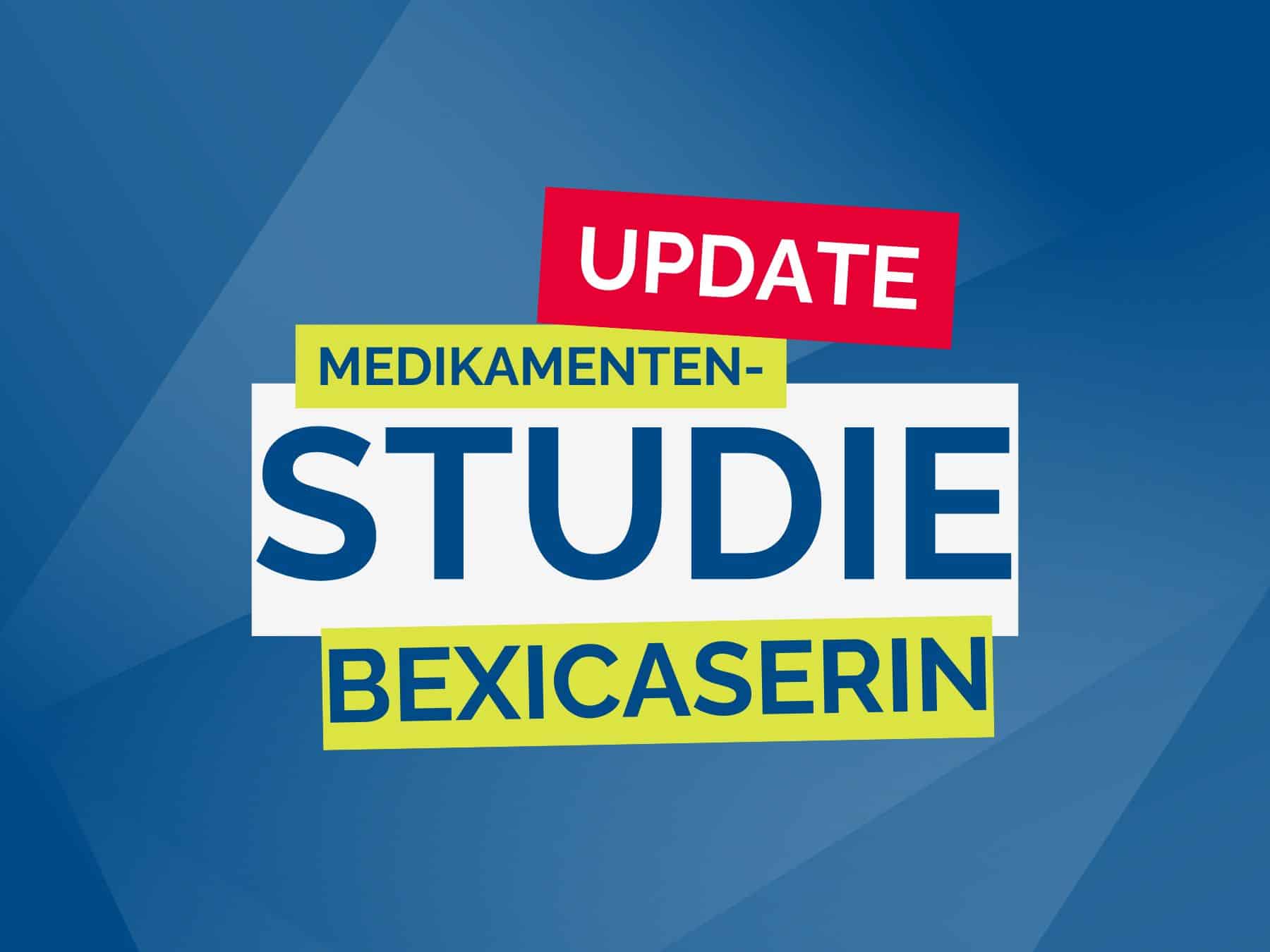In dieser im Jahr 2017 durchgeführten Online-Umfrage wurden 128 Eltern und 120 Geschwistern von Erkrankten mit schweren epileptischen Enzephalopathien wie dem Dravet-Syndrom und dem Lennox-Gastaut-Syndrom über die psychischen Einflüsse der Erkrankung auf die Geschwisterkinder befragt. Es zeigten sich unterschiedliche Wahrnehmungen verschiedener belastender Symptome durch Geschwisterkinder und Eltern. Die Autoren schlussfolgern, dass eine erhöhte Aufmerksamkeit und Erfassung des Unterstützungsbedarfs der Geschwisterkinder nötig seien.
Lebensqualität der Geschwister von Kindern mit schweren epileptischen Enzephalopathien
Autoren: Bailey, Gammaitoni, Galer, Schwartz, Schad
Affiliation: Firma Zoogenix in Zusammenarbeit mit der Unversity of Washington, USA
Veröffentlicht als Poster beim Kongress der American Epilepsy Society am 30.11.–4.12.2018 in New Orleans, USA, und als Posterabstract im Journal of Child Neurology 2018; 33 (9): S. 625.
ZUSAMMENFASSUNG
HINTERGRUND: Die Arbeitsgruppe Bailey et al. untersuchte den Einfluss von schweren epileptischen Enzephalopathien des Kindesalters wie dem Dravet-Syndrom und dem Lennox-Gastaut-Syndrom auf die Lebensqualität von Geschwisterkindern. Diese Forschung ist nach Ansicht der Autoren notwendig, weil die Sorge um die Lebensqualität der Geschwisterkinder die zweitgrößte Sorge der hauptversorgenden Personen darstellt (Villas et al. 2017) und bisher noch nicht umfassend untersucht wurde.
METHODISCH wurde eine Online-Umfrage in Zusammenarbeit mit Eltern von Kindern mit Dravet-Syndrom oder Lennox-Gastaut Syndrom entwickelt und zunächst in einer Beta-Version getestet. Die endgültigen Fragen wurden zwischen Juli und Dezember 2017 Eltern und Geschwistern unterbreitet, die über soziale Medien sowie Webseiten und Veranstaltungen von Elterninitiativen rekrutiert wurden. Die Umfrage umfasste Fragen zur Lebensqualität, zu depressiver Stimmungslage und zu Angstsymptomen. Die Teilnehmer wurden in vier Gruppen kategorisiert:
1. Geschwister im Alter zwischen 9–12 Jahren, 2. Geschwister im Alter zwischen 13–17 Jahren, 3. Geschwister älter als 18 Jahre und 4. Eltern. Die Fragen wurden insgesamt von 128 Eltern und 120 Geschwistern beantwortet, deren Angehörige in 47 Fällen ein Dravet-Syndrom, in 13 Fällen ein Lennox-Gastaut-Syndrom und in 55 eine andere Form einer schweren enzephalopathischen Epilepsie des Kindesalters hatten (Daten der Elternbefragung). Bei den Eltern beantworteten zum überwiegenden Teil die Mütter die Fragebögen, sie kommentierten darin den Einfluss auf zu 46% weiblich und im Durchschnitt 12 Jahre alte Geschwisterkinder. Die erkrankten Kinder dieser Eltern waren zu 47% weiblich und durchschnittlich 10 Jahre alt. Bei den Geschwisterkindern beantworteten am häufigsten 79 erwachsene Geschwisterkinder die Fragen, nur vierundzwanzig 9–12-jährige und nur siebzehn 13–17-jährige nahmen teil. Das Durchschnittsalter der teilnehmenden Geschwister war 24 Jahre, ihre erkrankten Geschwister waren im Durchschnitt 16 Jahre alt.
IM ERGEBNIS nahmen Eltern mehr als 20% weniger Angst- und Depressionssymptome bei den gesunden Geschwisterkindern wahr als diese selber berichteten. Bzgl. der Angstsymptome gaben in allen Altersgruppen (mit Ausnahme der 13–17-jährigen Geschwister) mehr als die Hälfte der Geschwister eine erhöhte Schreckhaftigkeit an, am häufigsten war die Schreckhaftigkeit bei den jüngsten Geschwistern im Alter von 9–12 Jahren. Auch depressive oder mürrische Stimmung war in den o.g. Altersgruppen bei mehr als der Hälfte der gesunden Geschwister vorhanden. Das Stressniveau und die Besorgtheit wurden von den Eltern höher eingeschätzt als von den Geschwistern selber. Traurigkeit und Wut über die Diagnose des kranken Geschwisters waren bei jüngeren Geschwistern eher im niedrigen Bereich einer Skala zwischen 0 und 10 angesiedelt. Die Sorge um die Aufmerksamkeit der Eltern war bei 50% jüngeren Geschwistern vorhanden, bei älteren Geschwistern mit 29 bzw. 33% seltener, und wurde von 56% der Eltern wahrgenommen. Das Unbehagen, mit anderen über die Diagnose des erkrankten Kindes zu sprechen, war bei den jüngeren Geschwistern bei 42% vorhanden, mit 88% in der Gruppe der 13–17-jährigen am größten, aber auch 68% erwachsene Geschwister und 71% Eltern hatten Schwierigkeiten damit.
SCHLUSSFOLGERUNG: Die Autoren schlussfolgern, dass Eltern sich um den emotionalen Einfluss der Erkrankung des Kindes mit schwerer enzephalopathischer Epilepsie auf die gesunden Geschwister sorgen. Sie betonen, dass bei den Geschwistern und den Eltern unterschiedliche Wahrnehmungen bzgl. depressiver und ängstlicher Symptome, Trauer und Wut, Besorgtheit und Stress, Aufmerksamkeitszuwendung und Unbehagen, über die Erkrankung zu sprechen, existieren. Sie schlussfolgern, dass eine erhöhte Aufmerksamkeit und Erfassung des Unterstützungsbedarfs der Geschwisterkinder nötig sei. Ärzte sollten die Auswirkungen der Erkrankung auf die Geschwister mit den Eltern diskutieren. Schließlich fordern die Autoren vermehrte Forschung, um von depressiven und ängstlichen Symptomen betroffene Geschwisterkinder besser erkennen zu können und Interventionen zu finden, mit denen sie besser unterstütz werden können.
KOMMENTAR UND EINORDNUNG: Diese Studie belegt in Messwerten, was Eltern von Kindern mit Dravet-Syndrom aus eigener Anschauung kennen, nämlich dass die Sorge um den Einfluss der Erkrankung auf die Entwicklung der Geschwister des erkrankten Kindes ein hochrelevantes Thema für die betroffenen Familien darstellt.
Für mich liegt ein besonderer Wert und Verdienst dieser Studie darin, dieses Thema in die wissenschaftliche Diskussion und Aufmerksamkeit der Forscher zu bringen. Darüberhinausgehende Interpretationen erlaubt das methodische Niveau dieser Untersuchung kaum. Angefangen von der Auswahl der Untersuchungsinstrumente über die Auswahl und Rekrutierung der Studienteilnehmer bis zur Methodik der Auswertung bietet die Untersuchung viele Kritikpunkte. Am meisten stört mich das Fehlen einer Bezugs- oder Kontrollstichprobe in nicht betroffenen Familien. Durch das Fehlen dieser Bezugsstichprobe fehlt den Messwerten jede Relation, man weiß gar nicht, ob der gemessene Wert viel oder wenig bedeutet. Auf den Alltag übertragen wäre es, als wenn jemand sagen würde: „Karl ist 34 groß“, aber dabei die Maßeinheit vergessen würde. 34 in Metern wäre ziemlich groß, in Zentimetern ziemlich klein. Wie die Messwerte dieser Studie im Bezug zu anderen Familien einzuordnen sind, was möglicherweise ein normales Niveau darstellt, was ein erhöhter oder erniedrigter Wert ist bleibt daher unklar.
Trotz der methodischen Kritik freue ich mich darüber, dass sich die Forschung des Themas der Entwicklung der Geschwisterkinder annimmt. Ich nehme aus dieser Studie mit, dass Eltern verstärkt auf depressive und ängstliche Symptome von Geschwistern bis zum 12. Lebensjahr achten sollten, da diese in der Untersuchung von Eltern deutlich unterschätzt wurden. Bezüglich der Besorgtheit und des Stressniveaus von Geschwisterkindern können sich Eltern etwas entspannen, dieses wurde von ihnen eher überschätzt. Wichtig scheint mir zu sein, dass die Entwicklung der Geschwisterkinder in den betroffenen Familien überhaupt angesprochen wird und die gesunden Geschwisterkinder bemerken, dass ihre Stimmungen und Ängste von den Eltern wahrgenommen und ernstgenommen werden.
Prof. Dr. Carsten Konrad