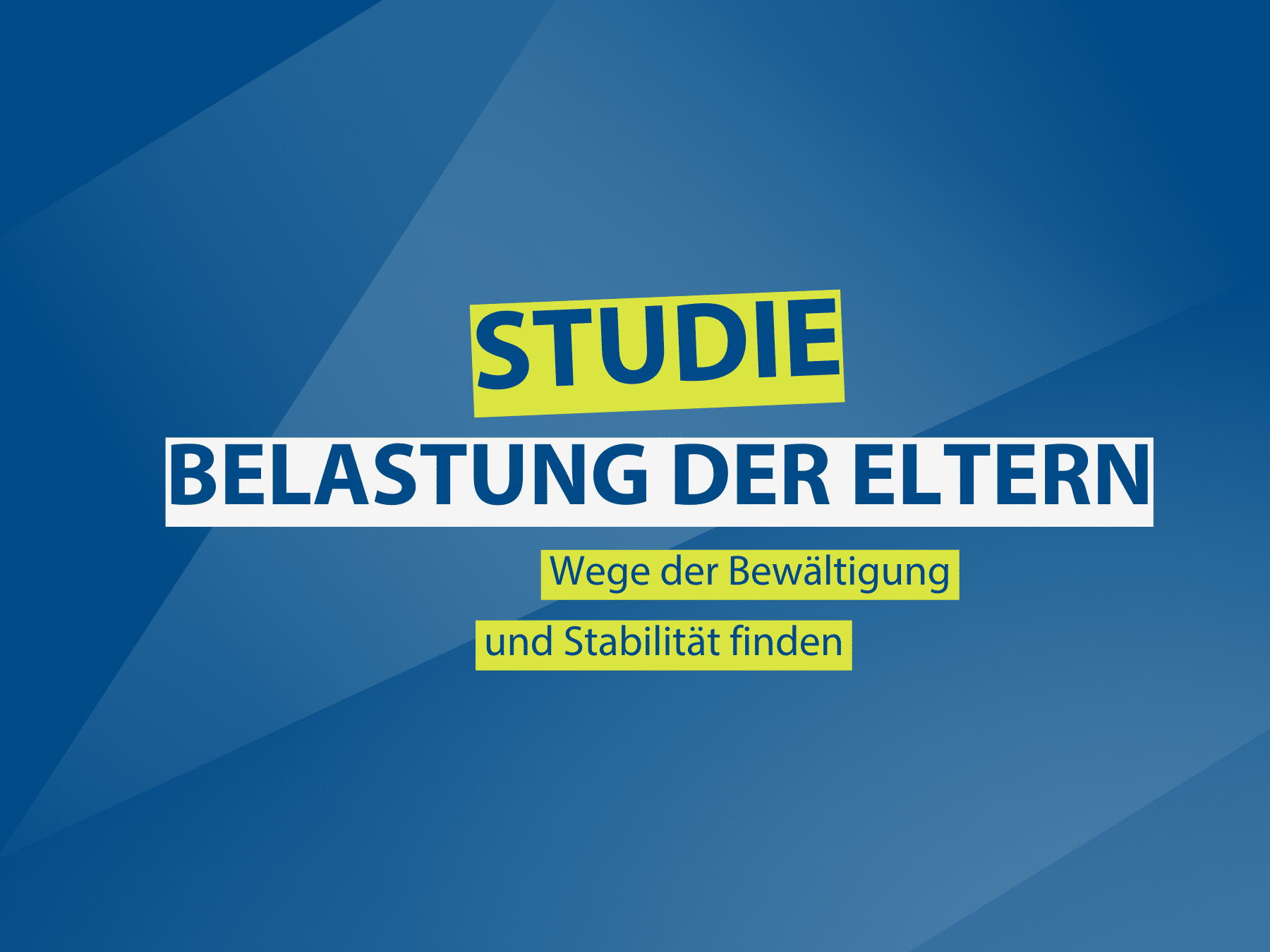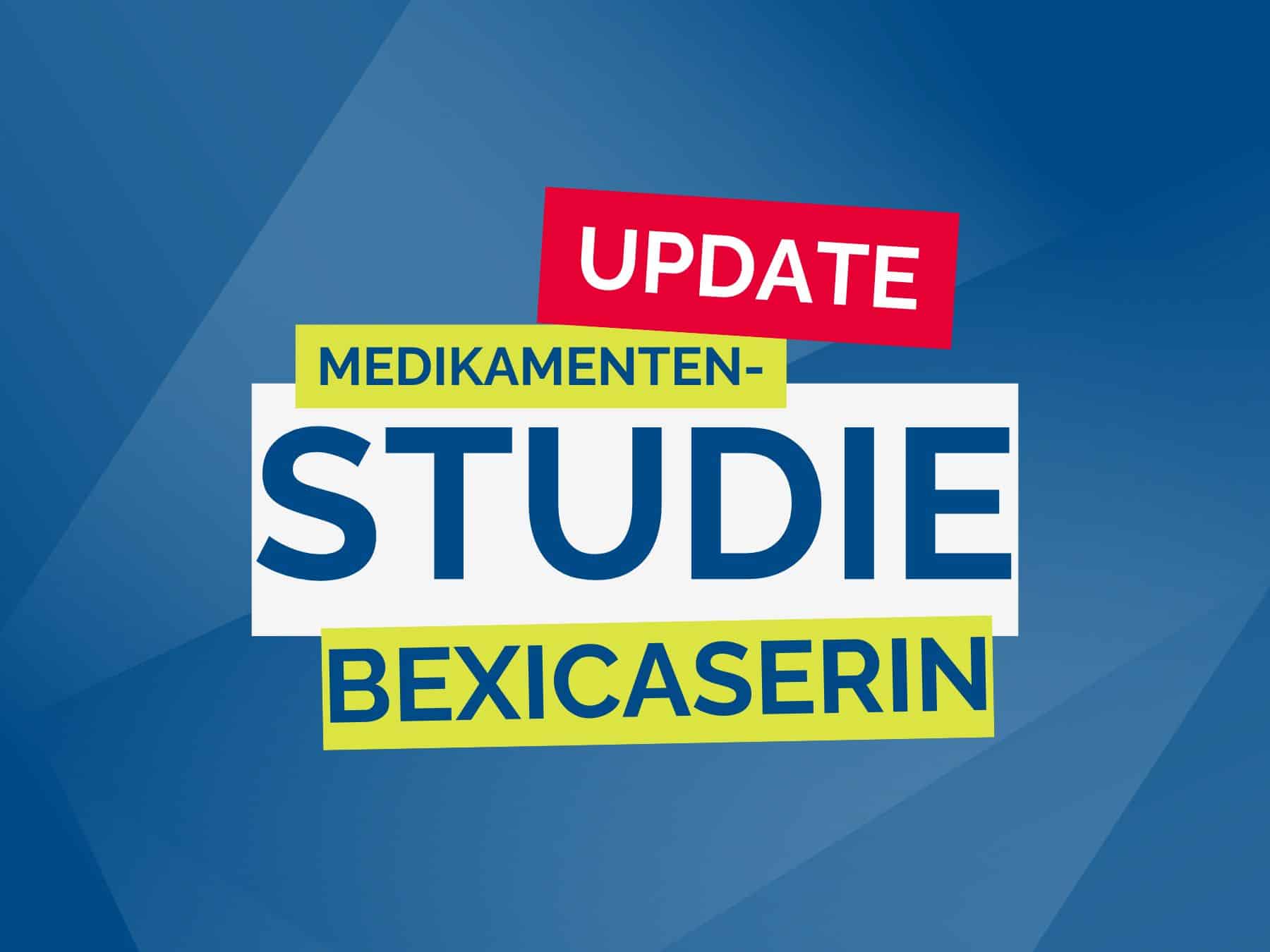Wenn ein Kind vom Dravet-Syndrom betroffen ist, geraten Familien oft in einen anhaltenden Ausnahmezustand. Anfälle, Notfälle, Unsicherheit und Schlafmangel prägen den Alltag. Viele Eltern beschreiben besonders die ersten Jahre als eine Zeit permanenter Alarmbereitschaft. Eine neue wissenschaftliche Studie hat nun genauer untersucht, was diese dauerhafte Belastung psychisch bedeutet und wie Eltern im Verlauf Wege finden, damit umzugehen.
Ein britisches Forschungsteam hat dazu ausführliche Gruppengespräche mit Eltern von Kindern mit Dravet-Syndrom geführt und ausgewertet. Im Mittelpunkt stand nicht die medizinische Behandlung, sondern die elterliche Erfahrung: Wie fühlt sich der Weg an? Was hilft beim Bewältigen? Und warum geraten manche Eltern in tiefe Erschöpfung, während andere mit der Zeit wieder mehr innere Stabilität entwickeln?
Worum ging es in der Untersuchung?
Für die Studie wurden 24 Eltern in moderierten Gesprächsgruppen befragt. Die Forschenden wollten verstehen, wie sich Belastung, Bewältigung und Anpassung im Laufe der Jahre entwickeln. Aus diesen Gesprächen entstand ein Modell typischer Anpassungsprozesse. Es beschreibt keine festen Stufen, sondern wiederkehrende Muster, in denen sich viele Erfahrungen der Eltern widerspiegeln.
Deutlich wurde: Die psychische Belastung ist kein Randthema, sondern ein zentraler Bestandteil des Lebens mit Dravet.
Leben im Schatten von Verlust und fehlender Unterstützung
Viele Eltern berichten von einem anhaltenden Gefühl des Verlusts. Gemeint ist nicht nur die Sorge um die Gesundheit des Kindes, sondern auch die Trauer um erwartete Lebenswege, um Selbstverständlichkeiten im Alltag und um frühere Zukunftsbilder. Diese Gefühle können in unterschiedlichen Lebensphasen immer wieder auftauchen, etwa wenn gleichaltrige Kinder Entwicklungsschritte machen, die beim eigenen Kind ausbleiben. Gleichzeitig schildern viele Familien einen Mangel an verlässlicher Unterstützung. Hilfen müssen häufig selbst organisiert werden, Zuständigkeiten sind unklar, Entlastung kommt spät oder gar nicht. Eltern erleben sich dadurch nicht nur als Sorge‑, sondern auch als Koordinations- und Kampfzentrum der Versorgung.
Die erste Zeit: Trauma und Überlebensmodus
Nahezu alle befragten Eltern beschrieben Situationen, die sie als traumatisch erlebt haben. Schwere Anfälle, Intensivbehandlungen, Reanimationssituationen oder die Mitteilung der Diagnose haben sich bei vielen tief eingeprägt. Manche sprechen ausdrücklich von Trauma-Symptomen, andere davon, bestimmte Erinnerungen kaum noch aufrufen zu können.
In dieser Phase schalten viele Eltern in einen Überlebensmodus. Der Alltag ist geprägt vom Funktionieren, Reagieren und Absichern. Innere Anspannung, hohe Wachsamkeit und ein Gefühl ständiger Alarmbereitschaft werden als Normalzustand erlebt.
Kontrolle als Bewältigungsversuch und ihre Grenzen
Um mit der Unsicherheit umzugehen, entwickeln viele Eltern intensive Kontroll- und Schutzstrategien. Sie eignen sich umfangreiches medizinisches Wissen an, beobachten ihr Kind sehr genau und trauen die Betreuung oft kaum jemand anderem zu. Das gibt zunächst Halt und Handlungssicherheit.
Langfristig kann diese Form der Daueranspannung jedoch an die Grenzen der eigenen Kräfte führen. Mehrere Eltern berichten in der Studie von Phasen tiefer Erschöpfung, von depressiven Episoden oder regelrechten Zusammenbrüchen. Die Forschenden ordnen das nicht als persönliches Scheitern ein, sondern als nachvollziehbare Folge chronischer Überlastung.
Wendepunkte: Wenn neue Formen der Bewältigung entstehen
Ein Teil der Eltern beschreibt im weiteren Verlauf einen inneren Wendepunkt. Oft entsteht er dann, wenn deutlich wird, dass der bisherige Dauer-Alarmzustand nicht durchhaltbar ist. Neue Bewältigungsformen entwickeln sich häufig dort, wo Unterstützung angenommen werden kann, Austausch mit anderen betroffenen Familien entsteht oder therapeutische Begleitung möglich wird.
Viele berichten, dass sie lernen mussten, Hilfe nicht nur als theoretisch sinnvoll, sondern als notwendig zu akzeptieren. Kleine eigene Freiräume, persönliche Interessen und bewusste Selbstfürsorge gewinnen wieder einen Platz. Damit verbunden ist oft auch die Wiederentdeckung einer eigenen Identität jenseits der ständigen Pflege- und Alarmrolle.
Integration statt „alles gut“
Die Studie beschreibt als mögliche spätere Entwicklung eine Phase der Integration. Gemeint ist kein Zustand, in dem die Belastung verschwindet. Vielmehr geht es um eine tragfähigere innere Einordnung der Situation. Einige Eltern berichten, dass die ständige Erwartungsangst nachlässt, dass sie stärker im Moment leben können und ihre Prioritäten sich verschoben haben.
Gleichzeitig bleibt das Leben mit Dravet verletzlich. Übergänge, Krisen oder neue Versorgungsabschnitte können alte Belastungsreaktionen wieder aktivieren. Anpassung wird deshalb als fortlaufender Prozess verstanden – nicht als endgültiges Ziel.
Was sich aus der Studie ableiten lässt
Die AutorInnen plädieren dafür, Eltern von Kindern mit Dravet-Syndrom frühzeitig traumasensibel zu begleiten. Psychologische Unterstützung, Elternangebote und Austauschformate sollten nicht als Zusatz, sondern als Teil guter Versorgung verstanden werden. Besonders der Kontakt zu anderen betroffenen Familien wird als entlastend und stabilisierend beschrieben.
Eine zentrale Botschaft der Studie lautet: Viele Reaktionen von Eltern sind normale Antworten auf eine außergewöhnliche Belastungssituation. Schwankungen zwischen Kontrolle und Erschöpfung, zwischen Hoffnung und Trauer gehören zu diesem Weg dazu.
Oder anders gesagt: Nicht alles, was sich schwer anfühlt, ist ein Zeichen von Schwäche. Oft ist es ein Zeichen davon, wie viel getragen wird.
Zur Studie
Hier geht es zur Studie: Mercier A. et al. (2025): Trauma, coping, and adjustment when parenting a child with Dravet syndrome.
European Journal of Paediatric Neurology.